 Marktkommentar Vontobel
Marktkommentar Vontobel
Marktkommentar von Mark Holman, CEO von Twenty-Four Asset Management: Das rasche Abflachen der US-Zinskurve wird wohl vorerst innehalten. Zuletzt schrumpfte das Gefälle zwischen den Renditen für zwei und zehnjährige Treasuries bis auf 24 Basispunkte.
Das deutliche Abflachen begann, als die US-Notenbank Fed mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik begann. Für das Kalenderjahr 2018 wird inzwischen mit vier Zinserhöhungen gerechnet, womit die Obergrenze des Leitzinses bis zum Jahresende bei 2,5 Prozent liegen würde. Da der sogenannte Dot Plot, der die anonymisierten Zinserwartungen der Fed-Mitglieder umfasst, für 2019 weitere vier Zinserhöhungen signalisiert, ist es durchaus möglich, dass die Zinskurve in den nächsten zwölf Monaten invertiert. Der Abstand zwischen den zweijährigen Renditen und dem Leitzins liegt gegenwärtig bei 66 Basispunkten und lag auch seit geraumer Zeit bei mindestens 50 Basispunkten – denn die Märkte erkannten, dass die US-Notenbank ihre Prognosen tatsächlich umsetzte. Sollte die Steilheit dieses kurzen Endes der Kurve anhalten, wäre bis zum Jahresende bei einem Leitzins von 2,5 Prozent eine invertierte Kurve mit zweijährigen Renditen von über 3 Prozent und zehnjährigen Renditen von weiterhin unter 3 Prozent möglich.
Es ist wohl etwas verfrüht, um von einer invertierten Kurve zu sprechen, solange wir uns mitten in einer sehr beeindruckenden Gewinnsaison befinden. Das vierteljährliche Bruttoinlandprodukt der USA wird wohl seinen Höchststand dieses Zyklus erreichen. Warum kam es also zu dieser Verflachung der Kurve?
Im Grunde sind dafür zwei Kräfte verantwortlich. Das vordere Ende ist mit jeder Zinserhöhung kontinuierlich gestiegen, während sich das lange Ende erholte. Dabei gaben die zehnjährigen Renditen von ihrem Höchststand von 3,12 Prozent im Mai auf 2,80 bis 2,90 Prozent nach und verharrten im letzten Monat auf diesem Niveau. Diese beiden entgegengesetzten Kräfte waren für das massive Abflachen der Kurve verantwortlich.
In den letzten Tagen haben sich die zehnjährigen Renditen jedoch von diesem Niveau gelöst und sind wieder auf knapp unter 3 Prozent gestiegen; auch der Abstand zwischen der Zwei-Jahres- und Zehn-Jahres-Kurve liegt wieder bei 30 Basispunkten.
Das lange Ende war in den letzten drei Monaten einem kontinuierlichen Strom schlechter Nachrichten von den Märkten ausgesetzt, wodurch langfristige Treasuries wieder in Mode kamen. Eine explosive Mischung aus Sorgen über einen Handelskrieg, Schwierigkeiten der Schwellenländer (Türkei, Argentinien und Brasilien) und politischer Unsicherheit in Europa hat die Märkte erschreckt. Die US-Notenbank bleibt jedoch entschlossen und sieht über all diese Entwicklungen hinweg. Damit signalisiert sie eine robuste anhaltende Erholung, eine Verbesserung auf den Arbeitsmärkten und einen allmählichen, aber keinesfalls besorgniserregenden Anstieg der Inflation. Kurz gesagt: Die US-Notenbank sieht keine Probleme, die Märkte hingegen schon. Die perfekte Kombination für ein Verflachen der Zwei- und Zehn-Jahres-Kurve. Der Strom schlechter Nachrichten versiegt jedoch inzwischen. Stattdessen treten positive Fundamentaldaten auf Unternehmensebene in den Vordergrund, und gute Nachrichten auf Makroebene werden sicherlich mit dem erwarteten Höchststand des US-Bruttoinlandprodukts folgen. Zudem scheinen bereits negative Neuigkeiten aus den Schwellenländern eingepreist zu sein.
Aus diesem Grund rechnen wir damit, dass längerfristige Zinsen im Sommer Spielraum nach oben haben und das Abflachen der Zinskurve, zumindest vorerst, eine Atempause einlegt. Natürlich könnte es immer zu „neuen Neuigkeiten“ kommen die Anlegerstimmung dürfte jetzt aber von den Fundamentaldaten bestimmt werden.
Verantwortlich für den Inhalt:
Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, Ch-8022 Zürich, Tel.: +41 (0)58 283 59 00 , Fax: +41 (0)58 283 75 00, www.vontobel.ch

 Der Hälfte des Asset-Management-Markts droht der Kollaps
Der Hälfte des Asset-Management-Markts droht der Kollaps Inflation und das Ende der geldpolitischen Stimuli liefern Bedenken
Inflation und das Ende der geldpolitischen Stimuli liefern Bedenken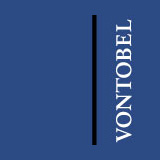 Vontobel Asset Management Marktkommentar
Vontobel Asset Management Marktkommentar Starker Greenback erhöht die Volatilität an den Emerging Markets
Starker Greenback erhöht die Volatilität an den Emerging Markets Das Urteil des Marktes: US-Aktien und defensive Branchen profitieren
Das Urteil des Marktes: US-Aktien und defensive Branchen profitieren Osteuropa profitiert von der guten Verfassung der Eurozone
Osteuropa profitiert von der guten Verfassung der Eurozone Krisen in Schwellenländern folgen nicht notwendigerweise auf Zinsanstiege in den USA
Krisen in Schwellenländern folgen nicht notwendigerweise auf Zinsanstiege in den USA Mehr als 80 Prozent der Deutschen besitzen ein Sparbuch, Tages-oder Festgeld
Mehr als 80 Prozent der Deutschen besitzen ein Sparbuch, Tages-oder Festgeld Trotzdem Investmentchancen in Europa, weiterhin gute Prognose für die USA
Trotzdem Investmentchancen in Europa, weiterhin gute Prognose für die USA Einführung des 4/6 Augenprinzips für voll digitale Freigaben
Einführung des 4/6 Augenprinzips für voll digitale Freigaben Aberdeen Standard Kommentar
Aberdeen Standard Kommentar Richards kommt von M&G Investments
Richards kommt von M&G Investments BNY Mellon IM Marktkommentar
BNY Mellon IM Marktkommentar Europas Aktienmärkte bieten interessante sektorspezifische Chancen
Europas Aktienmärkte bieten interessante sektorspezifische Chancen Kommentar von Lars Reiner, Gründer und Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters Ginmon
Kommentar von Lars Reiner, Gründer und Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters Ginmon