 Marktkommentar von Dr. Jens Ehrhardt, Vorsitzender des Vorstands der DJE Kapital AG
Marktkommentar von Dr. Jens Ehrhardt, Vorsitzender des Vorstands der DJE Kapital AG
Entgegen vieler Einschätzungen prognostizierten die beiden DJE-Marktausblicke 2018 und 2019, dass die amerikanischen Zinsen – trotz der Leitzinserhöhungen der US-Zentralbank im Bereich der wichtigen 10- jährigen Staatsanleihe-Zinsen – niedrig bleiben würden. Vor diesem Hintergrund wurde hervorgehoben, dass Aktien in den USA, aber auch weltweit, im Vergleich zu den gesunkenen Zinsen preiswert seien, unabhängig von der kurzfristigen Konjunktur- und Gewinnentwicklung. Entsprechend konnte sich die amerikanische Börse im vergangenen Jahr leicht verbessern – trotz der Bremspolitik der US-Notenbank FED. Im Laufe des Jahres 2019 warf die FED dann ihr Konjunktursteuerungs- bzw. Zins- und Liquiditätsruder um 180 Grad herum: Sie schaltete zunächst bei den Zinsen und dann bei der Liquidität voll auf Expansion – de facto die vierte quantitative Lockerung. Die monetären Börsenampeln stehen somit für 2020 klar auf Grün.
Abschwächung des Konsumwachstums bremst US-Konjunktur
Die fundamentalen Aspekte der US-Konjunktur sind hingegen schwieriger einzuschätzen. Entgegen allen Erwartungen fallen die US-Unternehmensgewinne (zuletzt -2,2%), und die Wachstumsrate der Volkswirtschaft dürfte zuletzt auf weniger als 1% zurückgegangen sein. Schon im dritten Quartal waren es allein die US-Konsumausgaben, das auf fast 5% vom BIP angewachsene US-Budgetdefizit und eine Lagererhöhung, die noch zu einem Wachstum von 2,1% (im Vorjahr noch über 3%) führte. Die US-Konjunktur steht also fast ausschließlich auf der Konsumsäule. Diese wiederum hängt ab von der Beschäftigung.
Hier gab es zuletzt leichte Einbußen bei der Gesamtzahl der gearbeiteten Stunden, bei der Länge der Arbeitswoche, bei der Anzahl der Teilzeitkräfte und bei der Geschwindigkeit der Lohnerhöhungen. Somit zeichnet sich auch eine Abschwächung der Wachstumsraten im Konsum ab. Die Notenbank war bisher zurückhaltend mit Stimulierungsmaßnahmen, weil man auf die stärkste Anspannung des Arbeitsmarktes seit rund 50 Jahren hinwies. Tatsächlich ist der Arbeitsmarkt aber kein Frühindikator. Dies gilt eher für die Investitionen, die nun schon im zweiten Jahr in den Wachstumsraten auf inzwischen nahe Null abgenommen haben. Dieser wichtige Frühindikator signalisiert also Konjunkturschwäche für 2020.
Alles eine Frage der Reize
Damit besteht im Grunde das „Goldilocks“-Szenario, das sich durch weite Strecken der Konjunkturentwicklung in den USA seit 2009 hinzieht. Die Konjunktur wächst ungewöhnlich schwach, was verstärkte monetäre Stimulierungsmaßnahmen der
Notenbank erfordert. Die Regierung hat zudem die Neuverschuldung auf den höchsten Wert in Friedenszeiten heraufgetrieben. Mit nahezu einer Billion US-Dollar Neuverschuldung bzw. rund 5% vom Bruttoinlandsprodukt wird am meisten in der
westlichen Welt stimuliert. Im Hinblick auf das Wahljahr 2020 dürfte Trump hier eher wieder für eine Beschleunigung der Verschuldung als für geringere Zuwachsraten sorgen.
Auch die US-Notenbank hat in Wahljahren bisher noch nie die Konjunktur mit Zinserhöhungen gebremst. Damit sind monetär und fiskalpolitisch die Geldschleusen für Konjunkturstimulierung geöffnet. Dies sollte sich im Jahresverlauf positiv auf die Wall Street auswirken.
Handelsstreit belastet weiterhin Weltkonjunktur
Schwieriger einzuschätzen sind die politischen Probleme. Der Handelsstreit mit China belastet die amerikanische Konjunktur durch Verteuerung der Importe aus China. Hinzu kommt, dass der Fall der Agrarpreise in den USA, bedingt durch weniger Käufe aus China und eine gute Ernte, die für Trump wichtige Wählerschaft in den Agrar-Swing-Staaten beeinträchtigt. Im Grunde braucht Trump dringend ein Abkommen. Kontraproduktiv war aus dieser Sicht die Unterzeichnung von Gesetzen, die Hong Kong unterstützen sollen. Hier wird sich China mit Gegenmaßnahmen, darunter auch Sanktionen gegen US-Unternehmen, wehren und die Weltkonjunktur weiter belasten. Die relativ gute Konjunktur in China mit überraschend stark gestiegen Frühindikatoren macht die Chinesen selbstsicherer – insbesondere bei ihren Verhandlungen mit Trump.
Wiederwahl – wenn die Wirtschaft brummt
Gelingt es Trump nicht, die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen, droht eine Wahlniederlage. In der Vergangenheit wurden US-Präsidenten nur bei boomender Konjunktur wiedergewählt. Auch die demokratischen Präsidentschaftskandidaten stehen nicht für eine Entschärfung des Handelskriegs mit China, denn über alle Parteien hinweg will man nach der Thukydides-Theorie einen wirtschaftlichen Aufstieg verhindern. Aber man wird mit Sicherheit die Trump’schen Steuersenkungen zu einem großen Teil wieder rückgängig machen, was Unternehmen und Konsumenten belasten würde. Die Gewinnspannen der US-Unternehmen fallen ohnehin wegen steigenden Lohnstückkosten bereits seit über drei Jahren. Vor dem Hintergrund der gewinnmäßig hoch bewerteten US-Aktien wäre eine Belastung bei den Unternehmensgewinnen eine Belastung für die Wall Street.
Abschwächung der US-Aktienrückkäufe mit negativen Folgen
Neben monetären und fundamentalen Einflussfaktoren spielt auch die Markttechnik eine wichtige Rolle für das Börsengeschehen in 2020. Die Hauptnachfrage nach US-Aktien geht weiterhin von den US-Unternehmen im Zuge von Aktienrückkäufen aus. Seit der Finanzkrise hat man bereits über 5 Billionen US-Dollar für solche Käufe der eigenen Aktien aufgewendet. Zuletzt lagen die Aufkäufe rund 20% unter Vorjahresniveau. Eine weitere Abschwächung – zum Beispiel wegen Gewinnrückgängen der Unternehmen – hätte klar negative Folgen. Ausländische Investoren sind an der Wall Street überinvestiert. Ein möglicher Rückgang des analytisch hoch bewertet erscheinenden Dollars würde wahrscheinlich zu ausländischen Aktienverkäufen führen.
Weitere Lockerungsmaßnahmen der US-Notenbank zu erwarten
Die Entwicklung des US-Dollars hängt wahrscheinlich weniger vom Zinsunterschied zu Europa ab als vielmehr von der zukünftigen Konjunkturentwicklung in den USA. Eine überraschende Abschwächung wird die US-Notenbank zu heute noch nicht erwarteten weiteren Lockerungsanstrengungen veranlassen. Auch im Hinblick auf die hoch verschuldeten US-Unternehmen könnte die heute neutral operierende US-Zentralbank massive Liquiditätsschübe veranlassen. Dies würde die US-Zinsen nochmals unerwartet drücken, was den Dollar negativ beeinflussen würde. Eine plötzliche US-Konjunkturschwäche würde den Dollar also drücken und zu einer Erholung des Euros führen. In Europa hat die Zentralbank in den letzten Jahren konsequenter stimuliert, was sich 2020 in einer relativen Verbesserung der Konjunktur äußern sollte.
Deutschland und Europa: politisch getriebene Konjunkturaussichten
Fiskalpolitisch dürfte es in Europa 2020 zu einer Lockerung kommen, was die Konjunktur ebenfalls positiv beeinflussen sollte. Gäbe es beispielsweise in Deutschland eine ähnlich starke Neuverschuldung wie in den USA, würde die Konjunktur boomen. Eine mögliche linke Regierung in Deutschland könnte eine Neuverschuldung durchsetzen mit entsprechender Signalwirkung für Südeuropa, wo ohnehin, besonders in Frankreich, mit vergrößerten Defiziten stimuliert wird. Eine grün-rot-rote Regierung könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland und Europa aus dieser Sicht positiv beeinflussen.
Allerdings dürften die Unternehmensgewinne durch Umverteilungsmaßnahmen belastet werden. Deutschland könnte 2020 zu jenen Börsen gehören, die am meisten politisch negativ beeinflusst werden. Am Ende spielt aber auch für die deutsche Börse ähnlich wie in den USA der monetäre Faktor die wichtigste Rolle. Nach vorangegangenen Korrekturen könnte der Kurs-DAX (ohne Dividenden gerechnet) aus seiner Seitwärtsbewegung, die bisher keinen Fortschritt seit dem Jahre 2000 gebracht hat, trotz heute wesentlich höherer Gewinne und Dividenden nach oben ausbrechen, was theoretisch ein charttechnisches Kurspotenzial auf rund 16.000 im Performance-DAX eröffnet.
Asien: Japanische Aktien besonders aussichtsreich – China mit Stärken
Die asiatischen Börsen sollten 2020 positiv durch das anhaltende Wachstum in China beeinflusst werden. Das gilt auch für Japan, das im Export verstärkt von China abhängig geworden ist. Japan ist nach der Wall Street jener Aktienmarkt mit den größten Aktienrückkäufen. Zuletzt haben sich diese Rückkäufe auf über 50 Milliarden US-Dollar fast verdoppelt. Da auch die Zentralbank über ETFs Aktien kauft und die internationalen Investoren so stark in Japan unterinvestiert sind wie vor der Abe-Regierung, könnte Japan markttechnisch 2020 begünstigt sein und im internationalen Vergleich überdurchschnittlich abschneiden. Die Bewertungen japanischer Aktien liegen im Hinblick auf Gewinn und Substanz im internationalen Vergleich auf besonders aussichtsreichem Niveau. Die japanischen Unternehmen haben mehr flüssige Reserven in der Kasse als das wirtschaftlich mehr als viermal so große Amerika. Mit seinen umfangreichen Investitionen der letzten Jahre in asiatischen Wachstumssektoren besteht auch erhebliches Wachstumspotenzial für die japanischen Unternehmensgewinne. Auch der Yen könnte seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Nach dem Wegfall der Deutschen Mark ist der Yen neben dem Franken international die beste Qualitätswährung, Japan das größte Gläubigerland der Welt (USA das größte Schuldnerland).
Edelmetalle langfristig mit Potenzial und Bedeutung
Die Aussichten für Edelmetalle, insbesondere Gold und Palladium, erscheinen längerfristig weiter positiv, auch wenn zuletzt eine übergekaufte Situation mit zu viel Optimismus herrschte. Nachdem Goldaktien seit vielen Jahren schlechter abgeschnitten haben als der Goldpreis, sollte auch bei diesen Titeln eine langfristige Umkehr nach oben möglich sein. Bedingt durch die stark gesunkenen Goldkäufe in China und dem Haupt-Goldkäufer Indien, könnte sich die Goldpreiserholung allerdings hinziehen.
Positive Aussichten für Dividendenaktien – Anleihen in der Hinterhand
US-Hedge-Fonds könnten bei freundlicher Börse wieder vermehrt US-Aktien kaufen, wo sie zuletzt die niedrigsten Investitionsquoten der Geschichte hatten. Fundamental macht es ohnehin Sinn, aus anderen Anlageformen in Dividendenpapiere zu tauschen. Im Vergleich zu Anleihen, wo die Zinsen sehr niedrig bleiben dürften, erwirtschaften die Unternehmen international im Durchschnitt 6-7% Rendite auf ihr Eigenkapital. Bei immer noch 12 Billionen US-Dollar Anleihen mit Negativzins wären Tauschoperationen in solide Aktien sinnvoll. Anleihen machen hingegen Sinn, wenn es international zu einem neuen, scharfen Konjunktureinbruch kommt, was nicht realistisch erscheint.
Verantwortlich für den Inhalt:
DJE Kapital AG, Pullacher Straße 24, 82049 Pullach, Tel: +49 89 790453-0, Fax: +49 89 790453-185, www.dje.de
 Johnson gelingt Vereinigung von „Leave Votes“ und Brexit-Ermüdeten
Johnson gelingt Vereinigung von „Leave Votes“ und Brexit-Ermüdeten
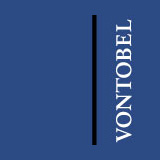 Marktkommentar von Frank Häusler, Chief Strategist bei Vontobel Asset Management
Marktkommentar von Frank Häusler, Chief Strategist bei Vontobel Asset Management Die Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ ist mit über 800 Fonds die zweitgrößte überhaupt. Bezogen auf das verwaltete Vermögen ist sie mit 420 Mrd. Euro sogar die mit Abstand größte Peergroup. Die Top-Fonds zeigt Ihnen mit einem Klick der ScopeExplorer.
Die Vergleichsgruppe „Aktien Welt“ ist mit über 800 Fonds die zweitgrößte überhaupt. Bezogen auf das verwaltete Vermögen ist sie mit 420 Mrd. Euro sogar die mit Abstand größte Peergroup. Die Top-Fonds zeigt Ihnen mit einem Klick der ScopeExplorer. Marktkommentar von Dr. Jens Ehrhardt, Vorsitzender des Vorstands der DJE Kapital AG
Marktkommentar von Dr. Jens Ehrhardt, Vorsitzender des Vorstands der DJE Kapital AG Ankauf eines qualitativ hochwertigen und großvolumigen Logistikportfolios
Ankauf eines qualitativ hochwertigen und großvolumigen Logistikportfolios Zielallokation entspricht defensivem Mischfonds
Zielallokation entspricht defensivem Mischfonds Die DWS ist zuversichtlich für die Entwicklung von Weltwirtschaft und Kapitalmärkten im kommenden Jahr.
Die DWS ist zuversichtlich für die Entwicklung von Weltwirtschaft und Kapitalmärkten im kommenden Jahr.  Die Real I.S. AG hat zentrale Risikokennzahlen für Immobilienfonds analysiert und Immobilienarten und -segmente hinsichtlich ihres Rendite-Risiko-Rankings differenziert.
Die Real I.S. AG hat zentrale Risikokennzahlen für Immobilienfonds analysiert und Immobilienarten und -segmente hinsichtlich ihres Rendite-Risiko-Rankings differenziert. 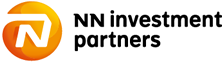 Bram Bos, leitender Portfoliomanager für grüne Anleihen bei NN Investment Partners:
Bram Bos, leitender Portfoliomanager für grüne Anleihen bei NN Investment Partners: Die Börse als Schachtel Pralinen: mit Unsicherheit umgehen lernen
Die Börse als Schachtel Pralinen: mit Unsicherheit umgehen lernen Zwei Drittel der Bundesbürger (68 Prozent) legen bei der Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit.
Zwei Drittel der Bundesbürger (68 Prozent) legen bei der Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit.  Der Qualitätsstandard Nachhaltiger Geldanlagen ist etabliert
Der Qualitätsstandard Nachhaltiger Geldanlagen ist etabliert