 Von Sébastien Thévoux-Chabuel, ESG-Analyst und Portfoliomanager bei Comgest
Von Sébastien Thévoux-Chabuel, ESG-Analyst und Portfoliomanager bei Comgest
Der Klimawandel stellt für Volkswirtschaften weltweit eine enorme Herausforderung dar. Wenn Investments nachhaltiger werden, dürfte das Forschern zufolge jedoch einen großen Einfluss auf den Klimaschutz haben. So ist es wenig verwunderlich, dass Finanzmärkte nach und nach grüner werden. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: Nur auf grüne Anlagen zu setzen, kann sehr gefährlich werden und ist langfristig nicht die beste Lösung. Vielmehr gibt es andere Wege, wie Investoren zur Dekarbonisierung beitragen können.
Ein Temperaturanstieg von 5 Grad bis zum Jahr 2100 hätte katastrophale Folgen für unser Leben auf der Erde. Die Zeit, um die Wirtschaft zu dekarbonisieren und den Klimawandel zu stoppen, läuft unaufhörlich ab. Das Bewusstsein dafür ist in der Gesellschaft und auf den Kapitalmärkten längst angekommen. Die Nachfrage nach grünen Anlageinstrumenten steigt, auch durch entsprechende regulatorische Vorgaben. Kurzfristig ist daher eine spekulative Blase bei grünen Aktien nicht auszuschließen. Darauf deutet die Entwicklung von Indizes wie dem MSCI World Environment oder ETF’s wie dem iShares Global Clean Energy hin. Grüne Branche sind hier selbstverständlich reichlich vertreten – etwa in Form von Elektromobilität, erneuerbaren Energien und nicht zuletzt Wasserstoff. Gleichzeitig sind die meisten grünen Unternehmen jung – selbst Tesla ist noch keine 20 Jahre alt – und befinden sich teilweise noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Es gibt deshalb einige kritische Punkte, die Investoren, welche ihr Vertrauen ausschließlich in grüne Aktien legen, nicht ignorieren sollten. Denn auch wenn die Rolle der Aktienmärkte prinzipiell darin besteht, Risikokapital bereitzustellen, um Wachstum und Innovation zu finanzieren, so stellt sich die Frage, ob es nicht zu früh ist, um gänzlich auf grüne Aktien zu setzen.
An dieser Stelle sei auf die Dotcom-Blase aus dem Jahr 2000 verwiesen: Viele Investoren hatten bereits damals erkannt, welch ungeheures Potenzial im Internet steckte. Allerdings waren sie ihrer Zeit um gut fünf bis zehn Jahre voraus, weil weder die Infrastruktur noch der Verbraucher für diese neue Technologie bereit waren. Was wäre also, wenn die heutige „grüne Welle“, die links und rechts auf uns einwirkt, genauso endet wie jene Euphorie, die damals alle Technologie-Aktien getragen hat?
Vorsicht vor Modeerscheinungen
Unsere Erfahrung als langfristiger Investor zeigt, dass man sich vor kurzfristigen Modeerscheinungen hüten sollte. Die Investition in Trends ist unserer Ansicht nach nicht der beste Weg, um langfristig erfolgreich anzulegen und zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beizutragen. Ein Bottom-up-getriebener Investmentansatz, der darin besteht, die mögliche Rendite und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten auf einer unternehmensbezogenen Basis zu bewerten, scheint die bessere Wahl zu sein. So vermeiden wir, uns von den neuesten Trends verführen zu lassen und identifizieren stattdessen die zukünftigen Gewinner im Sinne eines langfristigen und nachhaltigen Wachstums. Dieses Vorgehen führt auch dazu, dass wir eher in Old-Economy-Akteure mit einer langen Innovationsgeschichte investieren, die in der Lage sind, Lösungen für die Reduktion des CO2-Fußabdrucks zu bieten. In diesem Kontext kann die Unterstützung von Unternehmen, die die Kohlenstoffintensität von umweltverschmutzenden Industrien reduzieren, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der UN-Klimaziele leisten. Ein Beispiel hierfür ist das Schweizer Unternehmen Sika, das umweltverträgliche Lösungen für die Bauindustrie entwickelt: ein Sektor, der mit Blick auf die weltweit zunehmende Urbanisierung von zentraler Bedeutung ist, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Engagement: Abstimmen, diskutieren und im Extremfall verkaufen
Neben der gezielten Aktienauswahl für ihre Portfolios, sollten Fondsgesellschaften aber auch von ihrem nicht unerheblichen Einfluss Gebrauch machen und durch einen konstruktiven Dialog mit den Unternehmen Verbesserungen anregen. So ist die Wahrnehmung des Stimmrechts eine der wichtigsten und zentralen Aufgaben eines Anteilseigners. Denn nur durch seine Stimmabgabe auf der Hauptversammlung kann ein Anleger ein starkes Signal an die Unternehmensführung senden oder sogar eine Änderung der Strategie herbeiführen. Die Aufgabe von langfristig orientierten Aktionären besteht auch darin, die Unternehmen im Dialog dabei zu unterstützen, sich in Umweltfragen besser zu positionieren. Dabei geht es nicht um einen moralischen Zeigefinger, sondern einen langfristig angelegten, konstruktiven Dialog, um Bewusstsein zu schaffen und Verhaltensweisen langfristig zu ändern. Beispielsweise begann Inner Mongolia Yili, der führende Hersteller von Molkereiprodukten in China, im Jahr 2016 mit einer Strategie zur Reduktion seines CO2-Fußabdrucks, nachdem wir als langfristiger Anteilseigner und im ständigen Austausch mit dem Unternehmen stehend einen Best-Practice-Vergleich mit dem Wettbewerber Nestlé im Bereich des Umweltschutzes initiiert hatten. Das Unternehmen hat bereits 2016 seinen ersten Sustainability Report erstellt, 2017 die UN-Global-Compacts-Richtlinien unterschrieben und seit 2018 neun SDGs (Sustainable Development Goals der UN) quantitativ in seine Unternehmensplanung aufgenommen. Zudem erfüllt es seit 2020 alle Transparenzauflagen des Carbon Disclosure Project (CDP). Inner Mongolia Yili reduzierte auf diesem Weg zwischen 2012 und 2019 den CO2-Ausstoß pro Tonne hergestellter Produkte um 50 Prozent.
Zum Verantwortungsbewusstsein einer Fondsgesellschaft sollte aber auch die Bereitschaft zählen, sich im Extremfall von Aktien zu trennen, wenn es unüberwindbare ESG-Hindernisse gibt. So haben wir nach einjährigem Dialog mit dem Unternehmen unsere Aktien des chinesischen Videoüberwachungsanbieters Hikvision verkauft, da seine Technik zur Unterdrückung der chinesischen Minderheit der Uiguren in sogenannten Umerziehungscamps eingesetzt wurde, das Unternehmen jedoch nicht bereit war, sich von diesem Public-Private-Partnership-Projekt zu trennen. Von der Beteiligung am deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer haben wir uns nach der Übernahme von Monsanto sofort getrennt.
Die Masse macht den Unterschied
Gleichzeitig sind wir der festen Überzeugung, dass sich insbesondere im Kollektiv einiges bewegen lässt. So startete vergangenes Jahr eine Gruppe von 29 Investoren, die insgesamt ein Vermögen von 3,7 Billionen US-Dollar verwalten, die erste Anlegerinitiative gegen die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien. Comgest hat sich an diesem kollektiven Engagement beteiligt. Ein weiteres Beispiel ist die Teilnahme am Carbon Disclosure Project. 600 Investoren weltweit arbeiten aktiv mit, um den weltweiten Wasserverbrauch zu reduzieren, die Entwaldung einzudämmen und Klimarisiken einzuschränken. Durch die Vervielfachung der Stimmen und die Kombination des verwalteten Vermögens all dieser Anleger wird eine Hebelwirkung auf Unternehmen erzeugt, sodass diese sich umso mehr um eine nachhaltige Entwicklung ihres Geschäftsbetriebes bemühen müssen.
Keine Lösung auf Knopfdruck
Finanzmärkte, Investoren und Fondsgesellschaften können in vielerlei Hinsicht einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Erreichung der Klimaziele leisten. Allerdings ist das Thema eine Aufgabe auf Zeit, die langen Atem und eine klare Anlegervision erfordert. Eine Lösung auf Knopfdruck gibt es nicht – auch wenn das angesichts des Booms von grünen Aktien an der Börse zeitweise so scheinen mag.
Verantwortlich für den Inhalt:
Comgest Deutschland GmbH, Sky Office, Kennedydamm 24, D-40476 Düsseldorf, Tel.: +49 21144038721, www.comgest.com
![]() Es wird immer schwieriger, kleine Vermögen in Zeiten von Niedrigzinsen und anziehender Inflation gut anzulegen:
Es wird immer schwieriger, kleine Vermögen in Zeiten von Niedrigzinsen und anziehender Inflation gut anzulegen: 
 Xtrackers stellt Marktneuheit vor mit den ersten UCITS-ETFs auf Basis von Indizes, die speziell den Markt für „grüne“ Unternehmensanleihen abbilden
Xtrackers stellt Marktneuheit vor mit den ersten UCITS-ETFs auf Basis von Indizes, die speziell den Markt für „grüne“ Unternehmensanleihen abbilden Die G20- und G7-Staaten sowie die OECD haben sich auf die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für internationale Unternehmen von mindestens 15 Prozent geeinigt.
Die G20- und G7-Staaten sowie die OECD haben sich auf die Einführung eines globalen Mindeststeuersatzes für internationale Unternehmen von mindestens 15 Prozent geeinigt.  „Sowohl die USA als auch China könnten in Zukunft Wachstumseinbußen verzeichnen, während Europa noch eine Weile wirtschaftlichen Rückenwind erhält“,
„Sowohl die USA als auch China könnten in Zukunft Wachstumseinbußen verzeichnen, während Europa noch eine Weile wirtschaftlichen Rückenwind erhält“,  Offene Immobilienfonds sind gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen.
Offene Immobilienfonds sind gut durch das Corona-Jahr 2020 gekommen.  Das zweite Quartal 2021 war von leicht nachlassenden Handelsaktivitäten der Kunden der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) geprägt, allerdings wurden die Fonds- und ETF-Positionen der ebase-Kunden trotzdem weiter ausgebaut
Das zweite Quartal 2021 war von leicht nachlassenden Handelsaktivitäten der Kunden der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) geprägt, allerdings wurden die Fonds- und ETF-Positionen der ebase-Kunden trotzdem weiter ausgebaut Marktkommentar von Florian Ginez, Associate Director, Quantitative Research, WisdomTree
Marktkommentar von Florian Ginez, Associate Director, Quantitative Research, WisdomTree vbw Studie: Vorurteilen der Vermögensungleichheit auf der Spur – Brossardt: “Altersvorsorgeanwartschaften reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent”
vbw Studie: Vorurteilen der Vermögensungleichheit auf der Spur – Brossardt: “Altersvorsorgeanwartschaften reduzieren Vermögensungleichheit um über 20 Prozent” Der Bedarf an grünem Strom steigt unaufhörlich.
Der Bedarf an grünem Strom steigt unaufhörlich. 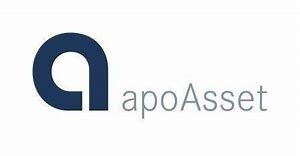 Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist laut FOCUS MONEY auch 2021 die beste Fondsanlagegesellschaft Deutschlands.
Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist laut FOCUS MONEY auch 2021 die beste Fondsanlagegesellschaft Deutschlands.  Weltweit sind die Schuldenberge durch Corona noch einmal stark gewachsen. Welche Wege führen aus der Schuldenfalle?
Weltweit sind die Schuldenberge durch Corona noch einmal stark gewachsen. Welche Wege führen aus der Schuldenfalle?  Index ist künftig auch Bestandteil der Anlageentscheidungen von Aberdeen Standard Investments
Index ist künftig auch Bestandteil der Anlageentscheidungen von Aberdeen Standard Investments Für den Großteil der letzten zehn Jahre hinkten europäische Aktien US-amerikanischen Titeln hinterher.
Für den Großteil der letzten zehn Jahre hinkten europäische Aktien US-amerikanischen Titeln hinterher.  Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt, und Volker Kurr, Head of Europe, Institutional, beide bei Legal & General Investment Management (LGIM) (Fotos anbei) erwarten in den Sommermonaten einen Renditeschub bei Schwellenländern:
Uday Patnaik, Head of Emerging Market Debt, und Volker Kurr, Head of Europe, Institutional, beide bei Legal & General Investment Management (LGIM) (Fotos anbei) erwarten in den Sommermonaten einen Renditeschub bei Schwellenländern: