 Aktuelle Befragung zeigt: Privatanlegerinnen und -anlegern fehlen Informationen, jede/r Dritte hat aber Interesse in Asien zu investieren
Aktuelle Befragung zeigt: Privatanlegerinnen und -anlegern fehlen Informationen, jede/r Dritte hat aber Interesse in Asien zu investieren
Wenn heute die 32. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit eröffnet werden, blickt die Welt nach Tokio. Erst zum siebten Mal findet dieser sportliche Wettstreit überhaupt in Asien statt – zum vierten Mal werden die Sommerspiele dort ausgetragen. Auch für Anleger ist Asien häufig noch ein unbekanntes Terrain – das legt zumindest eine aktuelle Befragung* von J.P. Morgan Asset Management nahe. Dabei folgt die Asien-Pazifik-Region, die 60 Prozent der Weltbevölkerung repräsentiert, in Sachen Wachstum dem olympischen Motto des „höher, schneller, weiter“. Die langfristige Wachstumsdynamik und strukturellen Veränderungen der Region sind so außerordentlich, dass in Finanzkreisen vom „asiatischen Jahrzehnt“ gesprochen wird. Doch noch ist die interessante Region in vielen Kundendepots deutlich unterrepräsentiert. Warum viele Privatanlegerinnen und -anleger sich noch nicht an Investments in Asien heranwagen versucht das Finanzbarometer – Sommer 2021, eine repräsentative Befragung von 2.000 Frauen und Männern ab 20 Jahren in Deutschland, zu ergründen.
Als Gründe, warum sie nicht in Asien investieren, nannten 40 Prozent der Befragten, dass sie über zu wenig Kenntnisse und Informationen über die Asien-Pazifik-Region verfügen. Mit 29 Prozent investiert rund ein Drittel der Befragten lieber heimatnah. Und einem Viertel ist das Risiko zu hoch. Nicht zuletzt gaben 18 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Umwelt- und Sozialstandards in der Region nicht ausreichen. „Gerade für die langfristige Anlage, etwa für die Altersvorsorge, sollte man sich die Wachstumsdynamik in Asien-Pazifik jedoch nicht entgehen lassen“, betont Holger Schröm, Executive Director bei J.P. Morgan Asset Management. So sorge der so genannte „Home Bias“, also die zu große Heimatliebe bei der Geldanlage, die sich nicht nur bei den Deutschen findet, eher für ein höheres Risiko im Portfolio, denn sie verhindere eine breite Streuung und dass alle Chancen wahrgenommen werden. „Grund hierfür ist die Informationsasymmetrie“, weiß Holger Schröm. „Über die Unternehmen und Wirtschaftsentwicklung im Heimatmarkt fühlt man sich einfach besser informiert als über die Marktteilnehmer in Fernost.“ Dabei gibt es heute einfache und bequeme Möglichkeiten, in Asien zu investieren.
Jede/r dritte Deutsche ist interessiert, in Asien zu investieren
So vertraut laut dem Finanzbarometer jede/r vierte Deutsche auf Investmentfonds in der Region: Diese legen breit gestreut an und bündeln das Know-how der Experten, die idealerweise vor Ort in den Ländern der Region arbeiten, die lokalen Sprachen sprechen und die Besonderheiten der Märkte kennen. Während 8 Prozent der Befragten Fonds oder ETFs nutzen, die in einzelne Länder Asiens investieren, bevorzugen 10 Prozent der Befragten Fonds oder ETFs, die mehrere Länder der Asien-Pazifik-Region bündeln. Weitere 11 Prozent investieren in Schwellenländerfonds, die neben Asien auch in anderen Regionen aktiv sind.
Drei Viertel der Deutschen investieren – noch – nicht in Asien. Allerding gab mit 34 Prozent rund jede/r dritte Befragte an, an einer Geldanlage in der Region interessiert zu sein. Weitere 41 Prozent sind nicht an Asien-Investments interessiert – aus den genannten Gründen. „Spannenderweise hat eine Befragung von Finanzberaterinnen und Finanzberatern im Frühjahr dieses Jahres ergeben, dass sie bei ihren Kunden eher eine Risikoaversion als einen Informationsmangel vermuten. Auch der Home Bias wurde als weniger gravierend empfunden. Mit Hintergrundinformationen über die verschiedenen globalen Märkte und die dortigen Anlagechancen sowie Beratung zur Diversifikation und Portfolioallokation könnten vielleicht noch mehr Privatanlegerinnen und Privatanleger davon überzeugt werden, dass es sich lohnt, in das ‚asiatische Jahrzehnt‘ zu investieren“, unterstreicht Holger Schröm.
Der Experte hat auch eine Idee für einen „Einsteigerfonds“ in die Region: Bereits seit 1988 bietet der bewährte Klassiker JPMorgan Funds – Pacific Equity Fund eine erfolgreiche Kombination aus Japan und „Emerging Asia“. Japanische Aktien bieten einen guten Diversifikationseffekt zum restlichen Asien und sorgen für ein ausgeglicheneres Risiko-Ertrags-Profil. Dafür werden Fonds und Management regelmäßig ausgezeichnet, zuletzt über alle Zeiträume bei den €uro Fund Awards. Der Fonds hält zudem ein 5-Sterne-Rating von Morningstar und Fondsmanagerin Aisa Ogoshi überzeugt Citywire seit fünf Jahren in Folge als eine der 20 besten Fondsmanagerinnen der Welt. Dank eines der größten Anlageteams vor Ort in der Region profitiert der Fonds von der lokalen Expertise und fundierten Erfahrung der Experten und investiert immer wieder in Unternehmen, die echte Entdeckungen sind. Und nicht zuletzt ist die Integration von ESG-Kriterien ein fester Bestandteil des Investmentprozesses.
Verantwortlich für den Inhalt:
J.P.Morgan Asset Management, (Europe) S.á.r.l. , Frankfurt Branch, Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt Tel.: 069/71240, Fax: 069/71242180, www.jpmam.de

 Zur Bekämpfung des Klimawandels: Neuberger Berman erhält Milliarden-Mandat von Brunel Pension Partnership
Zur Bekämpfung des Klimawandels: Neuberger Berman erhält Milliarden-Mandat von Brunel Pension Partnership ESG Quarterly Q3 2021
ESG Quarterly Q3 2021 Die aktuelle Auswertung zeigt: Rund die Hälfte der Anleger erwartet steigende Kurse in Deutschland und auf den weltweiten Märkten. Etwas mehr als ein Drittel fürchtet aber auch eine deutlich anziehende Inflation
Die aktuelle Auswertung zeigt: Rund die Hälfte der Anleger erwartet steigende Kurse in Deutschland und auf den weltweiten Märkten. Etwas mehr als ein Drittel fürchtet aber auch eine deutlich anziehende Inflation
 Marktkommentar von Axel D. Angermann, FERI
Marktkommentar von Axel D. Angermann, FERI Studie zeigt: Anlegerinnen haben ein höheres Selbstwertgefühl und sehen entspannter in die Zukunft als Sparerinnen / Finanzplanung als erster wichtiger Schritt zum Kapitalmarkt
Studie zeigt: Anlegerinnen haben ein höheres Selbstwertgefühl und sehen entspannter in die Zukunft als Sparerinnen / Finanzplanung als erster wichtiger Schritt zum Kapitalmarkt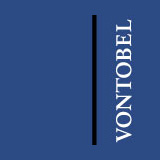 Von Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management:
Von Mark Holman, CEO von TwentyFour Asset Management: Aktuelle Markteinschätzung von Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
Aktuelle Markteinschätzung von Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ Diesseits und jenseits des Atlantiks stehen massive Infrastrukturausgaben bevor.
Diesseits und jenseits des Atlantiks stehen massive Infrastrukturausgaben bevor.  Anbieter Solidvest holt 2021 den ersten Rang / Studie über insgesamt 40 Robo-Advisor
Anbieter Solidvest holt 2021 den ersten Rang / Studie über insgesamt 40 Robo-Advisor